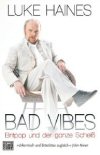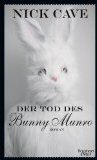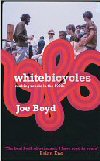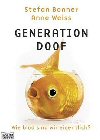|
Rezensionen Buch #01: |
|
|
|
24)
|
|
|
|
23)
|
|
|
|
22)
|
|
|
|
21)
Der einmal jährlich erscheinende Punchliner hat sich mittlerweile und löblicherweise als Literaturmagazin in Buchform für die Spielarten Slam Poetry und Satire in der Region und darüber hinaus etabliert. Die Beiträge pendeln zwischen Titanic, alten Mad und Hochkultur mit gelegentlichen Ausflügen in Richtung Schülerzeitung oder Comedy – die durchschnittliche Qualität ist also entsprechend durchwachsen, und hier greift daher ausnahmsweise einmal die abgelutschte Phrase „es ist für jeden Geschmack etwas dabei“. Gerade live kommen Texte der vorliegenden Art besonders gut. Bei Lesungen und Slams sind es der Vortrag und das gemeinsame Erlebnis, die den Moment und das Produkt zu etwas Einzigartigem, Großartigem machen. Wenn man dann als Besucher einer solchen Veranstaltung ein Druckwerk mit nach Hause nehmen kann, in dem man die Texte, die einem so viel Freude bereitet haben, nachlesen kann, dann hat man im Idealfalle die Stimme des Autoren im Ohr, dessen Betonung, Gestik, Mimik und Fans, die mit Zwischenrufen das Werk unterhaltsam ergänzen. Ein Riesenspaß für alle Beteiligten, und sei das Dargebotene im absolut seltenen Einzelfalle auch noch so unterirdisch. So ein Buch zu lesen ist dann in etwa so, wie sich nach dem Lieblingsfilm Standbilder daraus anzusehen. Doch wie ist das für Leser, die das Liveerlebnis nicht teilen, sondern ausschließlich zum Buch greifen? Die eröffnende Rubrik „Tinnef, Tand und Trödel“ erinnert an „Vom Fachmann für Kenner“ aus der Titanic und gibt ungefähr die Qualitätsspannweite des Folgenden vor. Manches ist sprachlich so ergreifend, dass man unabhängig vom Inhalt seinen Spaß an der Lektüre hat. Manches eröffnet einem unterhaltsame bis nachdenkliche Einblicke in alltägliche bis spezielle Begebenheiten. Und manches ist so brillant, dass man weder aus dem Lachen noch aus dem Staunen herauskommt. Wieder anderes hingegen ist so banal, dass man sich denkt: Den Gedanken hatte ich schon vor 15 Jahren in der Kneipe geäußert und keinen zwanghaft gestreckten Text daraus gemacht. Am Ende funktioniert das Buch also wie ein Musiksampler: Man kann Neues entdecken, ermittelt seine Favoriten und vertief seinen Blick in das Oeuvre Einzelner. Als kurzweilige Nebenbeilektüre auf dem Kaffeetisch macht sich der Punchliner ebenso gut wie am Bett, im Urlaub oder am Arbeitsplatz. Ein großer Pluspunkt ist der Stilmix: Vom Gedicht über die Kurzgeschichte und die Kolumne bis hin zum Comic decken die Autoren eine enorme Gattungsbandbreite ab. Und eigentlich weckt es den sehr starken Wunsch danach, die Autoren wieder live zu erleben. Denn wichtig ist auch, dass diejenigen, die überhaupt etwas machen (Literatur, Musik, Kunst, was auch immer), darin bestärkt werden, dies auch weiterhin zu tun. Natürlich muss eine Art Qualitätssicherung trotzdem greifen, aber es muss ja niemand mit seiner Kunst aufhören, nur weil einer mal sagt: Das find ich grad nicht so gut. Gute Kultur muss nicht von etablierten Vollprofis kommen (die hier aber auch vertreten sind). Die haben schließlich auch mal klein angefangen, zumeist. Also freut man sich schon jetzt auf den siebten Punchliner, der im Herbst 2010 im Reiffers Verlagsprogramm erscheint, und sieht zu, die textende Meute vortragend zu erleben. Von Matthias Bosenick (19.12.2009) |
|
|
|
20)
Das ist der Bildband für Leute, die keine Lust auf Bildbände haben, sondern lieber Platten sammeln wollen: Dieser kann nämlich beides. Eigenartig genug, dass es offenbar noch niemand zuvor für interessant gehalten hat, ungewöhnlich aussehende Schallplatten abfotografiert und kommentiert abzubilden. Als Sammler, der mehr als nur hören kann, freut man sich wie Bolle über dieses Buch. Man guckt sofort: Was gibt es denn noch so alles, was ich noch nicht habe? 500 nicht einfach nur schwarze und/oder runde Vinylplatten kompilierte Herr Benedetti hier, alles aus eigener Sammlung. Entsprechend viele Italo-Pop-Kleinodien der 80er-Jahre sind vertreten. Außerdem gehäuft treten Pink Floyd, die Beatles und Elvis auf. Aber um die Interpreten geht es hier ja nicht in erster Linie - es sind die Kleinodien selber, die hier das Aufsehen erregen. Die Reihenfolge hat Benedetti gut gewählt. Er hat die Vinyls in vier Kapitel unterteilt, nämlich nach einfarbigen, mehrfarbigen, Shapes und Pictures, gerne mit Überschneidungen. Los geht's mit gelben, dann deckt Benedetti sämtliche Farben ab, inklusive der braunen "Smells Like... (Shit Mix)"-Maxi-Single von Alien Sex Fiend. Die interessante Flut an geschmacklosen bis -vollen Pictures und Shapes ist kaum überblickbar. Toll ist auch, dass Vorder- und Rückseite des Buches mit einem Rillenprägedruck den Eindruck einer echten Schallplatte imitieren. Der Rezensent hat maximal vier der 500 Platten selber, aber dafür einige jagenswerte Schätze entdeckt (im Dunklen leuchtendes Vinyl! Also bitte!). Und sofort gedacht: Mit zwei, drei Leuten zusammengetan, kriegen wir so ein Buch mit links voll, und dann mit einem noch viel breiteren Musikgeschmack. Ein kurzer Gedanke an die eigene Sammlung lässt sofort 20 bis 50 extraordinäre Schallplatten erscheinen, inklusive der gelben 5"-Single von Grass Harp, der lila 7"-Single von Anthrax, der kunterbunten Picture-12" von !!!, der dreifach-Picture-LP der Drei Fragezeichen, der halb durchsichtigen und halb Picture-12" von Pearl Jam, der zwei farbigen Doppel-7"es von The Mission mit rotem, blauem, grünem und weißem Vinyl, der Etch-12" von Dinosaur Jr., der Fledermaus-Shape von den Specimen, der kotzgrün marmorierten Doppel-LP von Skinny Puppy, den gelb, orange oder blau durchscheinenden 12"es von Coldcut, der knallroten 12" der Skids, der himmelblauen LP von NoMeansNo, ..."Extraordinary Records" macht Spaß zu durchblättern und eignet sich bestimmt auch prima als Geschenk für befreundete Plattensammler, die ansonsten schon alles haben. Von Matthias Bosenick (22.07.2009) |
|
|
|
19)
Gleich zwei Bücher befassen sich mit dem wichtigsten Ereignis der jüngsten, wenn nicht der Geschichte überhaupt: Dem „Fall der Berliner Mauer“, der „Wende“, der „unblutigen Revolution“, dem „Ende des Kalten Krieges“, dem „Zusammenbruch der DDR“ – dem 9. November 1989, als Tausende von Menschen, Berlinern zumeist, auf den Hinweis von Politbüro-Mitglied Günter Schabowski hin, der bei einer Fernseh-Pressekonferenz einen ihm zugesteckten Zettel verlas, der besagte, Ausreisen in die BRD seien ohne Anträge möglich, „unverzüglich, sofort“, die Berliner Mauer erstürmten. In Ost und West verfolgten Menschen vor ihren Fernsehern das Geschehen und reagierten auf ihre ganz persönliche Weise. Diese zwei Bücher sammeln die Empfindungen und Erlebnisse von einmal 25 und einmal 17 Autoren, Theologen, Schriftstellern, Journalisten, Künstlern, Publizisten, aus Ost und West, nicht immer sogar aus Deutschland. Dabei verlegen sich beide Bücher auf unterschiedliche Schwerpunkte. In „Die Nacht, in der die Mauer fiel“ (DNIDDMF) bekommt man einen an Musik-Sampler erinnernden Überblick über das Schaffen unterschiedlicher Schriftsteller mit ihren Schreibstilen, in „Die Mauer ist weg“ (DMIW) nutzen die Autoren ihren Beitrag häufig als Plattform dafür, ihre Meinung zu äußern. Mitreißend sind beide Bücher. In vielen Erzählungen bekommt man Ansichten, Ideen und Eindrücke vermittelt, die einem sogar neue Sichtweisen eröffnen. Besonders die persönlichen Gefühle der Autoren lassen den Leser bisweilen erschaudern. War es wirklich ein Befreiungsschlag, als die Mauer fiel? Viele DDR-Bürger trauten dem Braten nicht und befürchteten härtere Sanktionen, wenn nicht gar eine blutige Lösung wie noch ein halbes Jahr zuvor auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Beijing. Viele Hoffnungen knüpften sich sofort an den Mauerfall, die Hoffnung auf Freiheit, Demokratie, florierende Wirtschaft, politische und soziale Gleichheit – und einige dieser Hoffnungen wurden hernach deutlich getrübt. Interessant sind besonders die Geschichten, die dieses umwälzende Ereignis mit der Vita des Autoren verknüpfen. Wenn eine Schriftstellerin nach Krakau reist, dort den Mauerfall im Fernsehen sieht und ihn mit Wein aus einem Puppenklo begießt. Wenn ein Schriftsteller beschreibt, welche internen Regeln er und seine Frau während seines kreativen Arbeitens aufgestellt hatten. Wenn eine Schriftstellerin erzählt, wie sie sich auf Kuba zum Fremdgehen hat verführen lassen. Wenn ein Schriftsteller davon berichtet, wie er den Mauerfall während seiner Armeezeit erlebte. Und vor allem, wenn man liest, wer alles in der DDR so mutig war, Dinge zu tun, die die Stasi direkt angelockt hatten, und wenn sie sich dann trotzdem nicht dazu haben zwingen lassen, von ihrem vermeintlich aufrührerischen Weg abzuweichen. Manche Autoren stellen einen historischen Zusammenhang her, der dem Leser ebenfalls die Augen öffnet, wie darüber, welche Bedeutung der 9. November im Deutschland des zwanzigsten Jahrhunderts hat, oder darüber, welche sozialen, politischen und wirtschaftlichen Folgen die „Wende“ bis heute hat. In DNIDDMF bekommt man unterschiedliche Erzähl- und Schreibstile präsentiert. Das ist in den allermeisten Fällen ausgesprochen unterhaltsam und liest sich gut weg, die Unterzahl der Autoren ergeht sich in pseudo-avantgardistischen Stilübungen oder ebenso mutwilligen wie sinnlosen Schlangensätzen. Da DMIW in einem evangelischen Verlag erschien, haben viele der Texte einen kirchlichen Bezug, was aber auch historisch bedingt ist, denn oft begannen die Revolutionen in der DDR im sicheren Schoß der Kirchen und gingen von dort aus auf die Straßen. Vor diesem Mut kann man als Leser nur größten Respekt haben. Umso weniger erfreulich ist es, wenn einzelne Autoren beginnen, davon zu lamentieren, wie ungerecht das Leben zu ihnen war oder dass sie es ja schon immer alles gewusst hätten, oder wenn sie gleich in Themen abdriften, die mit dem „Mauerfall“ absolut nichts zu tun haben, wie der medialen Verwertung von Kinderschändern. Oftmals ist in diesem Buch der Stil so sachlich, dass das Erzählerische an dem sogenannten Lesebuch verloren geht. In beiden Büchern begegnet man gelegentlich auch Autoren, die ihr eigenes Werk unbedingt thematisieren mussten; mit Einschüben wie „als ich gerade an meinem Buch ‚XXX’ schrieb“ langweilen sie mehr, als dass sie auf sich neugierig machen. Den meisten Lesern dürften die Namen der Autoren eher fremd sein. Dem Rezensenten war in der Tat lediglich Sibylle Berg ein Begriff, die zu DMIW einen Text beisteuert. Aber wie immer im Leben ist der Bekanntheitsgrad kein Qualitätsgarant – hier bekommt man auf jeden Fall gute Lektüre geboten, unterm Strich in DNIDDMF etwas mehr als in DMIW. Und man lässt sich anstecken, daran erinnern, was man selbst erlebt und gefühlt hat, als Genscher in Prag bejubelt wurde, als die Massen auf der für unüberwindbar gehaltenen Mauer tanzten, als die Verwandten endlich zu Besuch kommen durften, als die Entfernung nach Dresden von unendlich auf wenige hundert Kilometer schrumpfte, als Bagger begannen, Mauerstücke zu entfernen, die sich alsbald um den Erdball verteilt als Souvenir wiederfanden, als man sich mit seinen neuen Nachbarn, neuen Arbeitskollegen, neuen Urlaubsbekanntschaften, neuen Freunden und Lebenspartnern, neuen Künstlern zusammentat – und wie nicht viel später Abzocker, Besserwessis, Nörgelossis und Sozialschmarotzer Einzug in den Deutschen Wortschatz hielten. Und man stellt auch zwanzig Jahre nach diesem undenkbaren Ereignis fest, dass die Mauer immer noch existiert. Das muss man sich einmal vor Augen halten: Es gibt die DDR jetzt halb so lange nicht mehr, wie es sie gab. Es geht jetzt nicht darum, in verklärende Ostalgie zu fallen, aber es tut gut, sich mit Zeitzeugen zu unterhalten, und wer sich das nicht traut, hat die Gelegenheit, sich von insgesamt 42 Autoren ihre Sichtweise erzählen zu lassen. Von Matthias Bosenick (15.04.2009) |
|
|
|
18)
Das Buch zum Event. Damals... „Geht mal drei Tage lang spazieren, ohne eine Wolkenkratzer oder eine Verkehrsampel zu sehen. Lasst eine Drachen steigen, legt euch in die Sonne. Kocht euch das Essen selber und atmet saubere Luft.“ So stand es damals auf einem roten Plakat mit einer Friedenstaube auf einem Gitarrenhals. Das war 1969. Heute – 2009 - kann man zwar nicht mehr dabei sein, aber mit diesem Buch von Frank Schäfer kann man zumindest einen sehr gute Einblick davon bekommen, wie das damals so war (also ab in den Park bei dem schöne Wetter mit dem Buch). „Fakten, Fakten und immer an den Leser denken.“ Nach diesem Motto ist dieses Buch aufgebaut, ohne den zweifellos immer noch bestehende Mythos zu zerstören. Aber immerhin räumt es auf mit einigen verklärten Tatsachen und Gerüchten, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Da muss also erst so ein „Spätgeborener“ wie Frank Schäfer daherkommen, um dieses wichtige Buch zu schreiben, weil höchstwahrscheinlich keiner der damals körperlich dabei Gewesenen der „Generation Dope“ dazu in der Lage sein könnte. Wer jetzt einmal wissen möchte, wie das damals so war, warum John Entwistle von „The Who“ lieber seinen mitgebrachte Whisky getrunken hat und warum ihm das nichts genutzt hat, was Janis Joplin fernab der Bühne getrieben hat oder was für logistische und bürokratische Meisterleistungen vollbracht worden sind, dem sei dieses kurzweilige Buch empfohlen. Ich verrate hier jedenfalls nichts vorher, frei nach dem Motto: „Beschreiben, beschreiben und immer an den Autor denken...“ In diesem Sinne: Daumen hoch (oder lieber Zeige- und Mittelfinger...)! Viel Spaß beim Lesen, |
|
|
|
17)
Moin! Mistwetter? Zeit zum Lesen! Also, DER Clapton-Fan bin ich ja nicht, aber Matti (Bassart) meinte, dass das Buch lesenswert sei. Stimmt! Eric fängt gaaanz weit in seiner frühesten Kindheit an und erzählt locker, flockig, aber auch selbstkritisch und sehr intim über sein bewegtes Leben. Seine ersten Gehversuche an der Gitarre, Frauen, Drogen, Alkohol, Freunde und das schräge Leben eines Rockstars werden belichtet. Auch ohne den erhobenen Zeigefinger wird hier über Alkohol und Drogenmissbrauch geschrieben, wobei Mr. Clapton da schon sehr hart mit sich ins Gericht geht. Lustige Anekdoten mit bekannten Musikern sind aber auch an der Tagesordnung. Fazit: Alles in Allem ein sehr kurzweiliges Buch. Allerdings hätte die Cream-Phase nach meinem Geschmack etwas ausführlicher ausfallen können. Tip: Ausleihen aus der Musikbibliothek im Schloss (bring ich gleich zurück...). Von Michael „Schepper” Schaefer (01.04.2009) |
|
|
|
16)
Moin! Joe Boyd nimmt uns mit auf eine Reise in die 60er Jahre. Er war quasi Zeitzeuge und u.a. als Produktions-Tourmanager sowie als Produzent tätig. Hautnah beschreibt er die Musikszene mit Größen wie Pink Floyd, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Nick Drake, Bob Dylan, Miles Davis, Eric Clapton, Steve Winwood, Muddy Waters, etc. Er gibt einen prima Einblick in die Szene des Undergrounds, wie z.B. den UFO Club in London, die International Times, die Musiker, Produzenten, Frauen, Drogen, Schicksale. Das Buch liest sich leider zu Beginn etwas holprig, was aber an der schwachen Übersetzung liegt. Erst nach dem ersten Drittel kriegt der Übersetzer die Kurve und hat sich offenbar endlich auch mal mit den technischen Begriffen und Slangausdrücken auseinandergesetzt (Musiker, die „auf der Route“ sind, sowie einen „Kastenbass“ kenne ich irgendwie nicht... Ihr?...). Fazit: Schönes Buch, das tiefe Insider-Einblicke in die Musikszene und die Künstler der 60er Jahre gibt. Wenn' s geht, lieber auf englisch lesen, oder über die zuweilen echt schräge Übersetzung schmunzeln... Von Michael „Schepper” Schaefer (01.04.2009) |
|
|
|
15)
Der Titel scheint Thema und Stil des Buches vorzugeben, doch täuscht Schäfer hier, gottlob. Sicherlich geht es um Rockmusik, doch nur vordergründig, und auch verzichtet Schäfer darauf, ein unerträgliches Generation-Irgendwas-Buch à la „Golf“ oder „Doof“ abzuliefern. Vielmehr bezieht er sich, vor allem formell, auf den Vater aller Generation-Bücher, Douglas Couplands „Generation X“. Wie auch dort begleiten erläuternde Noten den Haupttext. Der wiederum erzählt keine durchgehende Handlung vom Leben eines Heavy-Metal-Fans in der ostfälischen Provinz, wie man erwarten könnte. Damit ist es für „Generation Rock“ schlecht möglich, in einer Reihe mit Heinz Strunks „Fleisch ist mein Gemüse“ (Tanzmusik auf dem Lande) und Rocko Schamonis „Dorfpunks“ (Punk auf dem Lande) zu stehen. Das will das Buch aber auch nicht. Schäfer nutzt das Medium, um bereits erschienene Texte sinnverknüpft zu kompilieren. Das ist sein gutes Recht und kommt jedem Leser, auch dem vielleicht darüber murrenden, zugute, denn sind Bücher einerseits von größerer Lebensdauer als Zeitschriften und ergänzte Schäfer sie andererseits um brückenschlagende und dadurch sinnstiftende Anteile. Nebenbei, auch Pünschel taucht in dieser Sammlung wieder auf. Schäfer erzählt, scheinbar autobiographisch, aus seinem Leben, quasi das Beste von kurz nach früher bis jetze, und nimmt das Oberthema „Rock“ als Bezugsgröße. Dabei ist Rock gar nicht in jedem der dreiunddreißig Kapitel tatsächlich vorhanden, jedenfalls nicht vordergründig. Hierfür gibt Schäfer jedoch in einem der vielen Randtexte eine überzeugende Erklärung ab, in einem Aufsatz über Chuck Klosterman nämlich, in dem es heißt: „[Klosterman] erzählt einfach ein paar locker zusammenhängende Geschichten, die sich dann doch beinahe absichtslos zu einer These verdichten – und was die mit dem eigentlichen Thema zu tun hat, muss man als Leser schon selber herausfinden.“ Damit überlässt er es also dem Endverbraucher, das Baumfällen, einen Badelandausflug oder des Ich-Erzählers Erziehungsmethoden in einen Kontext mit dem Rock zu bringen. Und selbst, wenn dem Leser das nicht gelingt, wird er sicherlich Vergnügen an den Anekdoten, Erinnerungen und Philosophien des „Helden“ haben. Die übrigen Geschichten formen ein Bild von der südlichen (nicht nördlichen) Lüneburger Heide, das der dort aufgewachsene und wohnhafte Leser zu großen Teilen teilt und also wiedererkennt. Dabei verzichtet Schäfer auf universale Alltagsbeobachtungen massentauglicher TV-Comedians, sondern beschreibt persönlich und zeitgleich nachvollziehbar, was eher demjenigen auffällt, der auch in der Lage ist, seinen Blick eine Nuance länger verweilen zu lassen – wenn er nicht die Allgemeinerlebnisse mit regionalen Geschehnissen verknüpft. So sind Arbeitsplatzbeziehungen wie bei VW sicherlich auch bei, sagen wir, Bayer in Leverkusen auszumachen, aber hat Bayer nie auf seinem Firmenparkplatz die Rolling Stones auftreten lassen. Bei allem stellt Schäfer nie jemanden bloß. Seine Absicht ist es nicht, die Land- und Provinzbevölkerung vorzuführen, und das ist gut so. Er entdeckt das für sich goutierbare an Orten, die jeder mit Verstand Beschenkte sonst aus guten Gründen meiden würde, wie einem Cover-Konzert in einer Dorfhalle. Er hat keinen Grund, mit seiner Herkunft zu hadern, auch wenn er deren Schwächen kennt. Ebenso kennt er nämlich auch seine eigenen, und genau dieser Aspekt macht es immer so sympathisch, Schäfers Texte überhaupt zu lesen. Er überhöht sich nicht, auch wenn er vom Besonderen in seinem Leben erzählt. Das ist vielmehr einer seiner zahlreichen Stärken. Richtig intim wird es, als Schäfer vom Tod seines Freundes Michael Rudolf erzählt. Dieser Text geht über die Ebene des erdachten Ich-Erzählers hinaus, das Kapitel ist sehr persönlich und offenbart viel über die Person Frank Schäfer. Solches schreibt man nicht, wenn man es nicht auch empfindet. An zweiter Stelle folgt der Abriss über seinen krebskranken Onkel, der zum oben erwähnten Stones-Konzert gegangen wäre, hätte er nicht Blut erbrochen. Um diese beiden zentralen Texte kreist der Rest des Buches mit Konzertberichten, Pubertätserfahrungen und Rezensionen (es geht unter anderem um Charles Bukowski, Full Metal Village und D:A:D). Dabei zieht das Thema Tod und Sterblichkeit den Leser nicht runter, sondern steht monolithisch aufgerichtet in der Mitte des Buches. Der Rest darum herum erst bedeutet das Leben, und sei es vom Rock dominiert. Wie gewohnt und beinahe schon erhofft befähigt sich Schäfer auch in dieser Textsammlung der unterschiedlichsten, ihm spürbar samt und sonders eigenen Sprachtiefen. Von der Hoch- bis zur Vulgärkultur, sollte es sie geben, beherrscht er die Stile und wendet sie auch thematisch allzeit passend an, ohne sich also anzubiedern, sondern den Inhalt mit der Form unterstreichend. Selbstverständlich lässt er seinen Ich-Erzähler auch mal ungerecht und polemisch sein, doch wer selbst, und sei er noch so politisch korrekt, ist das nicht gelegentlich auch gerne. Und wie es sich für einen gut erzählenden Autoren gehört, muss er den Leser gar nicht von Kiss oder Mötley Crüe überzeugen können, damit der das Buch trotzdem gerne und kopfnickend liest. Und hört. Denn dem Buch im Seven-Inch-Format liegt netterweise eine CD bei, und zwar mit einer bislang unveröffentlichten Aufnahme der Gruppe Salem’s Law, deren Gitarrist Schäfer einst war. Gedacht war die Musik als Nachfolger des Debütalbums „Tale Of Goblins’ Breed“, wurde vom Label seinerzeit jedoch sträflichst ignoriert. Selber Schuld, denn das rare Power-Metal-Debüt bringt inzwischen bis zu 90 Dollar auf die Waage. Überdies braucht sich auch die vorliegende CD nicht hinter Genrekumpels zu verstecken. Nicht nur Metal- und Rock-Fans finden also Vergnügen an „Generation Rock“, sondern auch diejenigen, die den Rolling Stone, die taz oder die Junge Welt nur Schäfers Texte wegen kaufen. Jener selbst zeigte sich übrigens nicht so recht zufrieden mit dem Titel, auch wenn der formell bestens gewählt ist. Er hätte ihn gerne, wie Bowie einst „Heroes“, in Anführungszeichen gesetzt. Das sei hier drei Sätze zuvor geschehen. Von Matthias Bosenick (26.08.2008) |
|
|
|
14)
Dieses Büchlein kompiliert zehn Gespräche, die Frank Schäfer für den deutschen Rolling Stone mit Schriftstellern führte. Im RS sind sie zwar alle erschienen, jedoch in gekürzter Fassung. Ein Grund mehr, sich dieses Buch zu kaufen; ein weiterer ist, dass man auf diese Weise die herrlichen Gespräche nicht erst wüst in seiner Heftsammlung zu suchen hat, sondern aneinandergereiht am Stück oder in eigenen Portionen zu sich nehmen kann. Die zehn Schriftsteller und Autoren in diesem Buch sind: Wolf Wondratschek, Eugen Egner, Peter Glaser, Max Goldt, Helge Schneider, Harry Rowohlt, Horst Friedrichs, Ludwig Lugmeier, Frank Schulz und Thomas Kapielski. Was für eine Bandbreite! Die Berufsbezeichnung „Schriftsteller“ ist hier aber auch wirklich nur die kleinstmögliche Schnittmenge der zehn Herren (ja, keine Dame ist dabei). Auch in Alter und nationaler Bedeutung ist die Spannbreite enorm. Man merkt dezent, dass Schäfer sich den Menschen nicht nur als Autor, sondern auch als Fan, als Bewunderer, als Wertschätzer nähert. Das äußert sich jedoch gottlob nicht in Schleimereien, sondern im größtmöglichen Respekt, den Schäfer den Personen entgegenbringt. Deutliche Worte, kritische Anmerkungen wagt er dennoch zu verlieren. Auch stellt er sich nie als Kumpel oder gar ebenbürtiger Kollege dar, im Gegenteil, Understatement ist des Herrn Schäfers Ding, und das, so mag man als Leser denken, obwohl er eigentlich als elfter in diese Reihe gehört, und wenn nicht jetzt sofort, dann doch spätestens in fünf oder zehn Jahren. Wenn er so weiter macht. Schäfer fungiert hier nicht als eigenständige Person, nicht als omnipotentes „Ich“, sondern als Mittler zwischen Interviewtem und Leser. Er verhält sich ungefähr so, wie man es selber den angesprochenen Autoren gegenüber auch tun würde: verhalten, neugierig, mit einer Mindestportion Hintergrundwissen, respekt- und bisweilen liebevoll, mit offenen Ohren und viel Verständnis. So macht es dem Nutznießer, der man als Leser ja ist, einen Riesenspaß, diese Gespräche zu lesen. Es ist, als würde man sich eben selber mit den Leuten unterhalten. Dadurch erfährt man viel mehr über die Angesprochenen, als man aus Eigendarstellungen oder anderen Interviews mitnehmen kann. Hinter den Literatur-Stars verstecken sich Menschen! In vielen Fällen ahnte, hoffte man das sowieso, und dank Schäfer erfährt man Bestätigung. Sympathen sind dies, allesamt. Zudem leitet Schäfer jede Gesprächsniederschrift mit einem knappen, aber ausreichend ausführlichen Bund an Informationen und Rückblicken ein, damit man das Folgende auch als Unbedarfter korrekt erfassen kann. So braucht man also keine Angst vor der Lektüre zu haben, wenn man mit einigen der Namen nichts anfangen kann. Hinterher kann man. Von jedem Schriftstellerportrait bleibt mindestens ein Element hängen, über das man sich auch Tage später noch freut. Wie Helge Schneider den Menschen „von den Rolling Stones“ grinsend mit „Hallo Mick!“ begrüßt. Dass Eugen Egner sich mit seinen surrealistischen Texten und Zeichnungen eigentlich nur gegen seine Nachbarn, gegen den Rest der ignoranten Welt wehrt. Über die „Titanic“-Rezension von Wolf Wondratscheks „Carmen oder bin ich das Arschloch der achtziger Jahre“, die schlichtweg „Ja!“ lautete. Dass Harry Rowohlts Übersetzungen auch autobiografisch sein können. Wie Max Goldt seinen erhobenen Zeigefinger allmählich eingeklappt zu haben scheint. Wie Ludwig Lugmeier seine Vergangenheit als Schwerverbrecher hinter sich lässt. Über Zeitgeschehen, das man als Nachgeborener nicht miterlebt haben kann, über politischen und kulturellen Kontext, über Deutschland früher bis heute. Und so weiter! So hat man am Ende zehn muntere und todernste Künstlergespräche und damit elf Personen, die einem ein Stück näher stehen als vor dem Lesen. Denn auch wenn Schäfer selbst in den Hintergrund rückt, macht ja genau das eine Aussage über ihn und ihn damit als Schriftsteller attraktiv. Von Matthias Bosenick (30.05.2008) |
|
|
|
13)
Über die beiden Autoren, die sich anmaßen, ein Porträt über die Generation, der sie anzugehören behaupten, verfassen zu können, erfährt man nichts, beispielsweise das Geburtsjahr. Als Leser lässt man sich ungern in einen Topf mit Leuten werfen, die möglicherweise im gleichen Alter sind wie man selbst, jedoch ein völlig anderes Leben führen, weil man selbst im Gegensatz zu ihnen gelernt hat, nachzudenken. Die von Bonner und Weiss betrachtete Generation ”Doof” ist zwischen 15 und 45 Jahren alt, sie selbst zählen sich dazu – und nehmen dies als Legitimation dafür, einen Schreibstil an den Tag zu legen, der von der Generation Doof auch ganz bestimmt verstanden wird. Ausgesprochen flapsig und mit lauter nervigen Pseudo-Wortspielen erzählen die beiden Jungjournalisten Geschichten aus ihrem Leben und belegen damit, wie blöd wir eigentlich sind (Titel-Unterzeile). Und das bei Bastei-Lübbe. Da könnte man gleich bei der BILD um politische Aufklärung werben. Das Cover des Buches erinnert deutlich an „Generation Golf“ von Florian Illies, grenzt sich inhaltlich aber davon ab. Das geschieht auch dadurch, dass Bonner und Weiss eben nicht nur eine mögliche Richtung erläutern, die die „Generation Doof“ eingeschlagen haben kann. Wer als Kind lieber mit Lego als mit Playmobil spielte, findet sich auch im Folgenden bei Illies nicht wieder. Bonner und Weiss wiederum versuchen, eine größtmögliche Bandbreite an Auswüchsen darzustellen, inklusive der Möglichkeit, dass man als Leser eben nicht zur „Generation Doof“ gehört. Als Nicht-Zugehöriger, der sich selber seine Gedanken über die aktuelle Weltlage gemacht hat, freut man sich recht häufig, dass endlich einmal jemand alles zusammengefasst und in Buchform herausgebracht hat, was einem selber bereits aufgefallen ist, von Fernsehen über Erziehung, Partnerschaft und Freizeitgestaltung bis hin zu Bildung, alle möglichen Miseren unserer Zeit. Es gibt sie doch, die Mahner, die Rufer im Walde, die holistischen Denker, die aufmerksamen Bildungsbürger, die Motivierten, die Interessierten. Meint man. Das Buch jedoch verliert sich häufig im schmuddeljournalistischen Nacherzählen dummer Begebenheiten. Natürlich haben die Autoren mit jeder als dumm entlarvten Situation recht, und es war überfällig, selbstsicheren Dummschwätzern den Rundum-Spiegel vorzuhalten. Recht so, denkt man. Und man stimmt ein wenig mit der Konsequenz überein, dass es an jedem selbst liegt, die Welt zu etwas Positivem zu verändern. Es liegt an uns, wie wir uns benehmen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie wir unsere Freizeit gestalten, uns ernähren und unsere Kinder erziehen, sofern wir welche haben. Es liegt auch an uns, wie sehr wir uns für Wissen interessieren, für Politik, Geschichte und Allgemeines, ja. Die Elysischen Felder sind in Sichtweite, wenn wir uns alle dahingehend verändern. Und doch meint man ständig, dass irgend etwas fehlt. Abgesehen davon, dass ein blöd betiteltes und flapsig geschriebenes Buch nicht die Welt verändern kann, steht man als Leser ohnehin erst mal alleine im beschriebenen Dilemma. Es liegt ja eben in aller erster Instanz an einem selbst, sich zu verändern. Wenn aber alle anderen nicht mitmachen, hat man es nicht unbedingt besser oder leichter. Sinkt etwa die Arbeitslosenquote, wenn ich mich gut kleide, gut benehme und vernünftige Zeugnisse vorweisen kann? Die Betriebe wandern ja trotzdem in den Osten ab – ganz einfach, weil es geht und einigen Wenigen Kohle bringt. Für die bereits verdummten, unverbesserlichen Mitglieder der „Generation Doof“ wird es auch nach einer Kurskorrektur keine zusätzlichen Arbeitsplätze geben. Für Ingenieure vielleicht, aber die wachsen nicht im Hartz-IV-Ghetto. Die Autoren machen sich auch keine Gedanken darüber, wer Vorteile von der grassierenden Verdummung der Massen hat, oder warum diese Verdummung andererseits vorangetrieben und von manchen Entscheidungsträgern nicht erkannt wird. Vielleicht deshalb, weil sie es sich mit potentiellen Geldgebern nicht verscherzen wollen, denn niemand pinkelt in das Boot, das ihn über den Fluss bringen kann. Oh, zorri, blöder Vergleich, aber damit dicht an der Sorte Sprachgebrauch, die auch die Autoren an den Tag legen. Die zitierten Geschichten der beiden Autoren tragen den Anschein, ausgedacht zu sein. „Neulich im Supermarkt“ gehört dazu, aber auch „die dreiundzwanzigjährige Jenny aus Chemnitz“. Typisch für Sachbücher sind die vielen Wiederholungen und gestreckten Ausführungen. Viel Blabla um wenig Inhalt – man hätte das Buch auch gut auf ein Drittel kürzen oder als Blogeintrag veröffentlichen können. Aber die Existenz des Buches bestätigt die Existenz der „Generation Doof“: Mit wenig Inhalt viel erreichen, dabei den Ton der vermeintlichen Zielgruppe treffen und schön um Applaus quengeln, aber sich bloß nicht mit Übergeordneten anlegen. Wie doof waren denn diejenigen, die entschieden haben, dieses mittelmäßige Buch zu veröffentlichen? Am Ende kommt das Fazit, dass doch alles gar nicht so schlimm ist, schließlich haben es die beiden Autoren ja auch zu etwas gebracht, zum Beispiel dieses Buch. Das Buch ist aber nicht gut, sondern offenbart die Oberflächlichkeit der „Generation Doof“ – q.e.d. Von Matthias Bosenick (26.05.2008) |
|
|
|
12) |
|
|
|
Die Hörspielserie „Gabriel Burns“ hat immensen und anhaltenden Erfolg, was gerade im hartumkämpften Hörspielsektor schon mal eine große Leistung für einen Newcomer ist. Was tut man also, wenn Merchandising alleine nicht dazu beiträgt, an noch mehr Geld der Fans zu kommen? Einen Film drehen? Noch nicht, das kommt dann später, immerhin sehen die Kino- und TV-Spots schon kinoreif aus. Nein, erst mal bringt man oldschoolmäßig Bücher heraus, aber gottlob nicht einfach nur „das Buch zur Folge“, sondern eigenständige Geschichten, die irgendwann vor und zwischen den CD-Folgen spielen. |
|
Formell unterscheiden sich die Texte nicht von dem, was man sonst zu hören bekommt. Und genau da liegt dann auch ein eklatanter Nachteil: Der Sprachstil ist zwar nicht scheiße, aber auch nicht sehr weit davon weg. Nicht ganz so trivial wie, äh, Bastei-Groschenheftchen, aber eben auch keine Literatur. Natürlich soll der Stil an den des Hörspielsprechers erinnern, aber gelesen fällt die Plattheit leider zu sehr ins Auge, die gehört noch genug gruselt. Und natürlich wäre die Zielgruppe mit einem höheren Anspruch überfordert, aber mit einem kleinen Maß an Sprachverstand gruselt man sich weniger über den Inhalt als über Sätze wie „Der Stängel einer Seerose verschwand in der Tiefe wie die Nabelschnur eines ungeborenen Kindes“ oder die Benutzung des Wortes „eh“ für „ohnehin“ im Erzähltext. Außerdem zeugt es ebenfalls nicht gerade von großer schriftstellerischer Begabung, Sätze mit bedeutungsschwangeren drei Punkten enden zu lassen oder wörtliche Rede mit „?!“. Beide Bücher verlassen seltsamerweise den Pfad des Unlesbaren nach ein paar Seiten und verlagern die Konzentration auf den temporeichen Verlauf der Handlung. |
|
Die des ersten Bandes „Die grauen Engel“ spielt direkt vor der ersten Hörspielfolge „Der Flüsterer“ und fügt sich inhaltlich wie Moltofill in die Informationsmauerritzen der CD-Serie. Oder so. Ein paar Details, die bei den Hörspielen fehlen, ergänzen das Bild, das man sich ohnehin kaum mehr zusammenreimen kann. Bakerman wurde von Pierre Trudeau persönlich mit der Fortführung der Kommission beauftragt? Soso. Ansonsten bekommt der Erstleser, der die Hörspiele nicht kennt, umgekehrt ganz viele Andeutungen, die er niemals verstehen wird. Damit ist also ausgeschlossen, dass mit den Büchern losgelöst von den CDs neue Märkte erschlossen werden können. Oder auch sollen, wer weiß. |
|
„Verehrung“ spielt irgendwann mittendrin, gegen ziemlich weit kurz vor Schluß der Serie soweit, und zwar in Mexico. Damit auch die Hörer, die die Bücher nicht lesen wollen, nichts verpassen, wird ein Volk eingeführt und gleich wieder ausgerottet, das mit anderen Methoden eine art Wolframtor hergestellt hat. In sich schlüssig, wie der erste Teil auch, schnell, spannend, fesselnd, das immerhin ist gut gelungen. Das macht ja auch den Reiz der ganzen Serie aus, dass ein Universum erzeugt wird, das zwar an sich abstoßend ist, aber dennoch den Geist gefangen nimmt und nach mehr dürsten lässt. Nunja, dafür ist gesorgt: Nächste Woche erscheinen die beiden neuen CD-Folgen (25: „...dem Winter folgte der Herbst“, 26: „R.“) und im November das dritte Buch („Kinder“). Mal sehen, in welchem Format Ullstein das dann veröffentlichen wird. Nebeneinanderstellen kann man die beiden vorliegenden Bücher jedenfalls nicht so einfach. Aber egal, was auch schlecht an den Büchern sein kann: Nicht lesen geht auch nicht. Von Matthias Bosenick (20.07.2007) |
|
|
|
11) |
|
|
|
Wenn Frank Schäfer sich schon als Vorleser in seiner Wahlheimatstadt rar macht, freut man sich als Leser eben umso mehr, ihn über das Rolling Stone Magazine hinaus hin und wieder auch in Buchform wahrnehmen zu können. Nach „Pünschel gibt Stoff“ ist dies nun seine zweite Geschichtensammlung im Maro Verlag. Aber schon der Titel legt nahe, dass man seltener zum Lachen kommt als bei der älteren Sammlung, denn den Blues, den erwischt Schäfer überzeugend gut. Zartbesaitete würden fast eine deprimierende Stimmung unterstellen, Schicksalsgenossen auf jeden Fall eine gute Beobachtungs- und ehrliche Wiedergabe attestieren. |
|
Die Geschichten spielen auf dem Lande, und zwar irgendwo zwischen Wolfsburg und Gifhorn, was man auch bei dem Tarnnamen „Giffendorf“ recht schnell durchschaut. Schäfer beobachtet sich selbst und seine Umwelt (Freunde und Kumpels) und zieht Vergleiche zwischen dem, was er heute wahrnimmt, und dem, woran er sich erinnert. Er geht dabei recht schonungslos mit verpassten Gelegenheiten und vergebenen Chancen um, beziehungsweise mit Möglichkeiten, die andere eher haben als man selbst. Das sind jedoch seltener berufliche als zumeist, auf den Punkt gebracht, sexuelle. Das mag vielleicht nicht wirklich interessant sein, was Enddreißiger heute so nicht erleben und was sie als Heranwachsende alles gerne erlebt hätten, aber kaum ein Thema kann so ein vortrefflicher Grund für einen Blues sein wie Unzufriedenheit in der Liebe und deren Verwandtheiten. |
|
Sowohl im Humoristischen als auch hier im austrocknenden See der Tränen geling es Schäfer, mit der Sprache die Stimmung zu treffen. Und in vielen Geschichten macht sich des Autors Dr. phil. bemerkbar, wenn er nämlich nach Gründen für die Gefühle oder gleich das ganze Scheitern seiner Figuren sucht. Aber wer sagt denn, dass sie alle scheitern; sie wählen nur andere Wege. Weniger sensible Menschen würden dieses mutmaßliche Scheitern als solches wahrscheinlich nicht einmal erkennen und selber noch in ähnlicher Situation von einem Erfolg sprechen – und genau darin liegt der von Schäfer betrachtete Blues. |
|
Typisch für Schäfer ist auch das Einbeziehung von Rock und Heavy Metal in seine Texte. Einer gebiert sich gar als schlichte Rezension des D:A:D-Albums „Soft Dogs“. Für Schäfers Geschmack wird man andernorts mittlerweile gescholten, aber er selbst geht mit einer gehörigen und berechtigten Portion Selbstbewusstsein damit in die Welt, dass man ihn nur bewundern und ihm beipflichten muß: ja, D:A:D sind nicht die einzigen Großen, die er erwähnt und seziert. Bei aller Akribie ist ihm jedoch ein winziger Fehler unterlaufen: Im Jahre 1988 kann „Sex Bomb“ noch nicht im Radio gelaufen sein, auch wenn es inhaltlich gerade passend ist. Und wann gibt es Neues von Pünschel? Von Matthias Bosenick (05.07.2007) |
|
|
|
10) |
|
|
|
Die Bücher des Ex-Braunschweiger Kolumnisten Axel Hacke, nicht zu verwechseln mit dem anderen Nun-Berliner Alex(ander) Hacke, kaufte man sich zumeist eher wegen der Illustratoren als wegen seiner Texte. So viele Bilderbücher des begnadeten Malers Michael Sowa sind nämlich leider nicht erhältlich, daher sammeln sich mit der Zeit lauter mittelmäßige bis überraschend gute Büchlein von Elke Heidenreich, Eva Heller und eben Axel Hacke im Regal an. |
|
Beim ersten „Handbuch des Verhörens“ war ebenfalls Sowa der Kaufgrund, beim zweiten zusätzlich der angeborene Vollständigkeitswahn des Sammlers. Hacke selbst sammelt ebenfalls, und zwar nach alter „Kiss-This-Guy“-Tradition Lieder, die von ihren Hörern falsch, aber irgendwie lustig verstanden wurden. Die Zeile von Jimi Hendrix ist da sehr populär, da hat nämlich jemand bei „Purple Haze“ nicht „when I kiss the sky“ verstanden, sondern sich über die homoerotische Aussage gewundert. Nachzulesen im Internet auf der gleichnamigen Webseite. |
|
Im Deutschen ist es Owi, mutmaßlicher weiterer Sohn Gottes, der aus „Stille Nacht“ den Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch fand. Und Hacke weiß von derlei Geschichten mehr zu berichten, hauptsächlich eingesandt von Lesern seiner Kolumnen und Zuhörern seiner Kolumnenlesereisen. Nun bekommt man aber nicht Abermillionen von Beispielen aufgelistet, sondern nur einige Dutzend, die aber prosaisch aufbereitet. An vielen Stellen muß man tatsächlich lauthals lachen und erinnert sich auch sofort an eigene Verhörer, die man Hacke sofort zusenden möchte. |
|
Aber dann weiß man, wie sie in seinen Texten verunstaltet würden. Hacke hat nämlich die Eigenart, das Berichtete mit eigenen Worten zu wiederholen und in einen meistens an den Haaren herbeigezogenen Kontext mit Zitaten oder anderen Beispielen zu bringen. Innerhalb der Kapitel werden die angeführten Verhörer bis zu dreimal gebracht, anstatt weitere Beispiele anzuführen. Die Zitierten tauchen doch ohnehin nur als „Herr H. aus B.“ auf, die kann er sich auch alle ausgedacht haben, warum denkt er sich dann nicht noch mehr Lustigkeiten aus und schiebt es dann „Frau M. aus S.“ zu? Zudem ist sein Schreibstil in keiner Weise wirklich so witzig, wie er selber offensichtlich glaubt. |
|
Möglicherweise sind Hackes Gedanken zum Verhören an sich recht aufschlußreich, aber nicht, wenn er da psychologisch und philosophisch zu sein versucht und eine Art Kult daraus macht, Lieder falsch zu verstehen. Und nicht nur Lieder, offenbar gingen ihm die Beispiele aus, denn er erweitert das Spektrum um alltägliche Verhörer, die man beispielsweise beim Nachrichtenhören als Kind in den 80ern hatte, wie „Ohrschinken“ statt „Washington“. Ganz nett, ja, aber letztlich beliebig, da Kinder sich nur deshalb verhören, weil sie manche Wörter einfach noch nicht kennen, und da kann man ja alles anführen. |
|
Oder sich auch an nicht so bekannte Lieder und Musiker wenden. Damit könnte man Leser vielleicht dazu bringen, sich musikalisch ein bißchen umzuorientieren. In Richtung der kürzlich reformierten Flowerpornoes gar, in deren „Liane“ es heißt, „cool ist das Wort dafür“, wenngleich es Tom Liwas entspannter Gesang mutmaßen läßt, es hieße „Kuh ist das Wort dafür“. Die Münchener Freiheit sang in „Herz aus Glas“: „ich erkenn dich, wie du immer warst“, doch verstand man absurderweise „ich erkenn dich, wie du im A warst“, und wunderte sich. Oder Kraftwerks „Radioaktivität“, die „für dich und mich im All entsteht“, und gottlob nicht „für dich und mich in allem steht“. Um das Buch vollzukriegen, würde Hacke mit diesen drei Beispielen mehr als eine halbe Seite füllen, indem er eine Geschichte drumherumkonstruiert und die Beispiele nach Kolumnistenart zyklisch aufeinander Bezug nehmen läßt. Da hätte dann möglicherweise eine Kuh namens Liane im A ein radioaktives Glasherz stehen gehabt, und so was wäre ja nicht gut. Oder so. |
|
So ist der Wumbaba, den Hacke nebenbei noch zum eigenständigen Fachwort für Verhörer machen will, kaum mehr als recht unterhaltsam. Sowas Bilder sind natürlich toll, dem modernen Surrealismus verpflichtet. Dafür lohnt sich der Erwerb wiederum. Von Matthias Bosenick (09.03.2007) |
|
|
|
09) |
|
|
|
Was soll man immer von Künstlern halten, die ihr Ressort verlassen? Können Musiker, die in ihren Texten beweisen, daß sie sich gute und interessante Geschichten ausdenken können, auch als Schriftsteller bestehen? Nick Cave tat dies mit „And The Ass Saw The Angel“ („Und die Eselin sah den Engel“, auf deutsch nun mal nicht so schön doppeldeutig, das Bibelzitat), aber wird es dem einzigen lebenden kreativen Avantgardemusiker unserer Zeit gelingen? Ok, so stimmt das natürlich nicht, Claypool ist gottlob nicht alleine auf der Welt, aber dennoch einzigartig. Schon Primus waren mehr als nur Funkram für Indie-Kids, aber erst mit seinen sämtlichen Soloprojekten (Frog Brigade, Oysterhead, Sausage, Les Claypool’s Bucket Of Bernie Brains) und seinen diversen Kollaborationen (Tom Waits, Gabby La La, Adrian Belew) zeige er, daß er auf den Markt nicht schielt, und obwohl an der Presse vorbei musiziert, jedoch eine große und treue Anhängerschaft bedient. |
|
Das erste, woran man bei Les Claypool und Geschichten denkt, ist Fisch. Irgendwas mit Angeln. Und genau so ist es auch. Man kennt die dreiteilige „Fisherman Chronicles“, den Titel „Sailing The Seas Of Cheese“, das nautische Cover des Albums „Tales Of The Punchbowl“ und seine beiden Folgen bei „Fly Fishing The World“. Nahezu parallel zum vorliegenden Buch veröffentlichte er ein Soloalbum namens „Of Wales And Woe“ sowie die DVD mit der Dokumentation der Primus-„Tour de Fromage“ namens „Blame It On The Fish“. Allein um Käse geht es gar nicht. |
|
Sondern um die ungleichen Brüder Ed und Earl. Aufgewachsen in einem Kaff bei San Francisco, ging der jüngere, Ed, einen anderen Weg als Earl. Ed zog nach San Francisco, studierte, heiratete eine Schwarze, bekam ein Kind und ist weltoffen, liberal und von halluzinogenen Pilzen begeistert. Earl war schon immer das einfachere Gemüt, blieb in El Sobrante, steht auf das billige Crank, hat einen prügelnden Proll zum besten Freund und eine notgeile Frau geheiratet, die ab und zu mal verschwindet. Die Brüder hatten sich wegen der größer gewordenen Unterschiede eine ganze Weile nicht gesehen. Erst der Tod des Vaters läßt sie wieder aufeinandertreffen und einen Angelausflug planen, wie sie sie in ihrer Kindheit mit ihrem Vater hatten. Auf den Stör soll es gehen, in der Bucht, „südlich des Pumpenhauses“. |
|
Claypool verdeutlicht mit Rückblenden die Unterschiede zwischen den beiden Charakteren, vergleicht die vergangene und die gegenwärtige Stimmung miteinander und läßt allmählich die Handlung in Schwung kommen, denn Donny, der dominante Prollfreund von Earl, will an dem Ausflug teilnehmen. Da Donny und Ed sich noch nie leiden konnten, ist damit der Konflikt ins Boot installiert. Zunächst geht es verbal zur Sache, mit Dialogen und Argumenten, die man sich als intelligenter Mensch den Ignoranten gegenüber selber oft wünscht. Leider sind gute Argumente immer aussichtslos, gerade weil man es eben mit Ignoranten zu tun hat. Während Ed auf einem heimlichen Pilztrip ist, schniefen die anderen ihr Crank. Nach anfänglichen Streitereien und Frotzeleien mildert sich das Klima, als alle auf ihrem Trip sind und der Riesenstör an der Angel, und plötzlich kommt es zur angebahnten Katastrophe, jedoch von völlig anderer Seite als erwartet. Und dann wird das Buch durch seine drastische Deutlichkeit sehr eklig und endet mit einer weiteren überraschenden Wendung. |
|
Der Sprachstil, den Claypool sich aneignet, pendelt zwischen vulgärem Slang und Hochsprache, wobei man deutlich spürt, daß der Autor der Hochsprache zugeneigter ist und den Slang nur ebenfalls beherrscht. Er versetzt sich überzeugend in den asozialen Menschenschlag und vertritt doch merklich die liberale Haltung von Ed. Der Spannungsaufbau funktioniert beinahe wie ein Rausch, wie ein schneller werdender Fluß. Langsam und in ihrer Darstellung überzeugend tastet sich Claypool an seine drei, wenn man den Riesenstör mitzählt vier, Hauptfiguren heran, baut die Konstellationen auf und läßt dem Wahnsinn seinen Lauf. Geschickt entläßt er den Leser auf dem Höhepunkt der Wortgefechte in die drogenbedingte Entspannung, um einen Atemzug später das Blut nur noch schneller durch den Körper rauschen zu lassen. Als Leser verkrampft man mit den Figuren, selbst wenn die Spannung am Schluß so konstruiert aufgebaut wird wie im Groschenroman, was aber dann auch egal ist. Man muß dann allerdings einen starken Magen haben. |
|
Diese Drastizität, die Claypool an den Tag legt, verwundert ein wenig, auch in der gelegentlichen Darstellung der Sexualität seiner Figuren. Jedoch vertiefen diese Elemente den Eindruck nur, den man als Leser von den Personen haben soll. Bei aller Ekligkeit hat man es doch mit einem fesselnden Buch zu tun, das einem nicht zuletzt auch einen Einblick in die unterschiedlichen Schichten der amerikanischen Westküstenbewohner gibt. Es hat das Zeug zu einem Insider-Klassiker, wie das Buch von Nick Cave. Von Matthias Bosenick (02.02.2007) |
|
|
|
08) |
|
|
|
Das ist doch genau das, was den Rezensenten interessiert: Ein Polizist aus Kopenhagen wird nach West-Südjütland versetzt, wo er sich mit den soziokulturellen Unterschieden im eigenen Lande auseinandersetzen muß. Als Reisender in Dänemark erfährt man nämlich alsbald, dass es erhebliche Unterschiede zwischen Kopenhagenern, die ihr Stadt für das Zentrum des Königreiches halten, und Jüten, die den Ruf haben, nichts weiter als kulturlose Bauern zu sein, gibt. Die gegenseitigen Vorbehalte sind für Außenstehende zumeist unterhaltsam, wie es mit Köln-Düsseldorf, Nürnberg-Fürth, Siegerland-Sauerland und so fort ja auch ist. Und nun schreibt ein Däne quasi über Interna. |
|
Hauptfigur ist Robert, der geschieden lebt, ein Kind hat, eine im Rollstuhl sitzende Mutter und seinen Ex-Schwiegervater als Chef bei der Polizei. Jener legt ihm nahe, aufgrund seiner Unbelastbarkeit besser in ruhigere Gefilde zu wechseln, und versetzt ihn nach Højer in Sønderjylland, knapp an der Nordsee, mit Tønder als nächstgrößerer Stadt, nur wenige Kilometer nördlich der einzigen Landesgrenze, die Dänemark hat. Sein in Ruhestand gehender Vorgänger informiert ihm über einige Eigenarten, beispielsweise, dass man erwartet, dass Ladendiebe verprügelt werden, anstatt ein rufschädigendes Protokoll aufzunehmen, und dann muß Robert alleine zurechtkommen. |
|
Schnell wird klar, dass in der Stadt nichts geheim bleiben kann – jeder weiß sofort alles. Auch, dass Robert es nicht schafft, die Gewalt an Ladendieben einzudämmen. Gewalt wird ohnehin ein Problem, denn es gibt da ein Ehepaar, das aus Jørgen, einem prügelnden Cowboy, und Ingerlise, einer ohnehin skeptisch beäugten Ost-Südjütländerin, besteht. Beide haben noch ein Kind und halten ihre Ehe dadurch lebendig, dass sie öffentliche Gewaltspielchen durchführen. |
|
Parallel dazu wird erzählt, wie Roberts Mutter sich in sexuellen Ausschweifungen hingibt, und dass Robert seine Tochter vermisst, die mit ihrer Mutter und deren neuem Gatten in Australien lebt. Man erfährt Roberts Gedanken, Sorgen und Probleme, man beobachtet seine Aufnahme in die Stadtgesellschaft, man erfährt von seiner unrechten Liebe. Zu Ingerlise nämlich, die er, nachdem Jørgen sie erneut verprügelte und sich dann komatös besoff, versehentlich mit seinem erigierten Glied in ihrem Gesicht tötet. Nachdem die Schuld von ihm genommen werden kann, erschießt er auch noch Jørgen, in den sich mittlerweile Roberts auf Besuch weilende Mutter verliebt hat. Die neue Leiche verschwindet im Moor, die Mutter wird mit Beruhigungsmitteln kaltgestellt und Ex-Frau mit Tochter kommen zu Besuch. Die Polizei aus Tønder findet nur falsche Leichen mit kompromittierenden Vergangenheiten und lässt den Fall lieber ruhen. Robert erarbeitet sich den überfälligen Respekt bei seinem Ex-Schwiegervater und lehnt die Rückkehr nach Kopenhagen ab. |
|
Schon an der Zusammenfassung erkennt man, dass einige Elemente ziemlich übertrieben wirken. So kann man es durchaus auffassen, und genau das macht das Buch so wenig reizvoll, zusammen mit einem Stil, der zwischen Enid Blyton und Henning Mankell schwankt. Jepsen gelingt es nicht, Magie zu erzeugen. Er hält jeden Leser für dumm und erklärt alles, was ansonsten ein hervorragender erzählerischer Kniff gewesen sein könnte. Beispielsweise, als die Nachbarskatze beginnt, mit ihm zu sprechen, folgt sofort, dass Robert sich das natürlich nur so vorgestellt hat. Und sobald die beiden Kinder ins Spiel kommen, benutzt Jepsen Ausrufezeichen, dass man sich an die „5 Freunde“ erinnert fühlt. Man wäre sofort geneigt, „Dreck am Stecken“ (im Original eher „Wüst glücklich“) für ein Kinderbuch zu halten, wenn es nicht andererseits um absurde Sexgeschichten, Saufen und Mord ginge. Dazu ist die Handlung auch noch derartig geradlinig, dass sie langweilt. |
|
Die Konsequenz aus allem ärgert zusätzlich. Robert verschweigt diese beiden Morde, für die er jedoch von der natürlich allwissenden Stadtbevölkerung geschätzt wird, weil denen die beiden Leute selber auf die Nerven gingen, und hat auch noch Erfolg damit. Was soll uns das sagen? Wendet Selbstjustiz an, wenn ihr genervt seid, es wird euch niemand nachtragen? Das, was an dem Buch tatsächlich interessant ist, nämlich die eingangs erwähnten Unterschiede zwischen Kopenhagenern, West-Südjüten und auch Deutschen, hätte man auch hervorragend in einem knappen Dutzend Seiten abhandeln können, wenn man die ganzen leider auch noch herangezogenen Klischees mit einbezöge. Wenn schon Schriftsteller aus Dänemark, dann lieber Bjarne Reuter. Von Matthias Bosenick (13.12.2006) |
|
|
|
07) |
|
|
|
Der Titel gibt den Inhalt der über 300 Seiten langen Reise komprimiert wieder. Sofort hat man gewisse Vorstellungen davon, was man auf einer solchen Tour erleben könnte, und stürzt sich auch gleich auf die Lektüre. Greve ist Journalist, bezogen auf Reisen eher zufällig, aber dadurch auch für GEO Saison, und hat sich zum Ziel genommen, eine 8.000km lange Tour einmal im Zickzack an der Deutschen Grenze entlang zu machen, mit Stippvisiten in allen Anrainern, ausgehend von Aachen, weil das im Alphabet ganz oben und auf der faltbaren Karte genau auf dem Knick liegt. Ein durchaus nachahmenswertes Unterfangen. |
|
Gegen den Uhrzeigersinn schlägt er sich (streckenweise in Begleitung von einem Justus und einem Jonas…) durch Belgien, Luxemburg, Frankreich, die Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen, Dänemark und die Niederlande. Viele der Gegenden hat der Rezensent selber schon, im wahrsten Sinne, erfahren, hat ebenfalls mit Einheimischen gesprochen und Kurioses erlebt, und denkt nun, daß er genausogut seine Erfahrungen zu einem Buch hätte zusammenfassen können. Unterm Strich sicherlich nicht, denn Greve ist doch weit mehr Journalist als man selbst und hat auch verzweigtere Bekanntschaften. |
|
Allerdings überfordert er den Leser zu Beginn ein wenig. Er reißt Inhalte nur an, gibt die extrem vielen Informationen nur begrenzt weiter und setzt entweder enorm viel Vorwissen voraus oder fordert paralleles Recherchieren. Beispielsweise stehen irgendwo ganz viele Menschen vor dem meistbeguckten Giebel im Elsaß, aber Greve erwähnt nicht einmal die Stadt. Zudem komprimiert er seine Eindrücke und Routenerklärungen so stark, daß man besonders aufmerksam lesen muß, um alle Sprünge mitzumachen (manches wäre durch mehr Absätze vielleicht deutlicher voneinander getrennt). Und er bildet zunächst nur ab, bisweilen erwartet man doch eine Stellungnahme oder Meinung zu manchen Ereignissen. Aber wahrscheinlich hat er derartig viel erlebt, daß ein ausführliches Buch dazu mindestens doppelt so dick geworden wäre – möglicherweise aber auch besser lesbar. Immerhin ändert sich das zum Ende hin. |
|
Nichtsdestotrotz lädt das Buch zu vielerlei Nachahmung ein. Man sollte ohnehin mehr mit den Einheimischen sprechen, wenn man unterwegs ist, egal, ob im In- oder Ausland. Die Geschichten, die Greve beschreibt, kann man zum Teil auch selber erleben, wenn man denn offen dafür ist. Man sollte seine Neugier bewahren und pflegen, immer offen sein für das, was einem nicht nur selber widerfahren, sondern auch berichtet werden kann. Interessant ist eben auch, daß viele der Gegenden, die Greve abklappert, vor sechzig Jahren noch oder noch nicht zu Deutschland gehörten, und was deren Bewohner heute zu erzählen haben. Und es ist schön, von Regionen zu lesen, die man selber schon besucht und zu denen man eine ähnliche Meinung hat. |
|
Im Falle des Rezensenten ist dies die Vorliebe für Dänemark, wo Greve einige Jahre gewohnt hat und wovon er in einer ähnlichen kindlichen Begeisterung schwärmt, immer überrascht, daß das Land auch negative Seiten haben kann, sofern sie sich offenbaren. Spätestens jetzt fällt dem Leser auch auf, daß Greves Ton milder, persönlicher und einfühlsamer geworden ist. Anfangs war er noch teilweise gezwungen humorig, ohne es wirklich zu sein, bedient bisweilen gar unangenehme Klischees (Kriminalität und Straßenstrich in Tschechien, Auto in Polen nicht alleine lassen, Türkischer Dealer auf Sylt, und: „farbig“ sind wir alle!), aber manches funktioniert wohl besser über (Vor-)Urteile, man hat eben ein bestimmtes Bild vor Augen, wenn man weiß, an welcher Stelle der Karte Greve sich gerade aufhält. |
|
Zur persönlichen Note des Buches gehört auch, daß Greve manche eigene Schwäche gesteht. Technische Unbefangenheit hier, ein plötzlicher Anfall von Fremdeln dort rücken ihn noch näher an die Position, die auch ein nachahmender Leser einnehmen könnte. Vielleicht liegt es ja auch an Greves Neigungen, daß die Süddeutsche Hälfte des Buches so unstrukturiert und distanziert wirkt, die Norddeutsche hingegen so wohlwollend und übersichtlich. Obwohl er seine einzige wirklich schlechte Erfahrung, und auch das teilt er partiell mit dem Rezensenten, im Emsland gemacht hat. |
|
Am Ende möchte man es in zweierlei Hinsicht wie Greve selbst halten: Er spricht, in Aachen zum zweiten Male angekommen, davon, gleich noch einmal die Runde zu machen; der Leser hat die Wahl, das Buch erneut zu lesen – oder sich selbst auf die Socken zu machen. Im Zweifelsfalle kann er sich auch noch die beiden Mitbewerber zulegen, „Deutschlandalbum“ von Axel Hacke und „Deutschland, eine Reise“ von Wolfgang Büscher. Eines noch: Er meint sicherlich Mont Saint Michel, nicht Saint Malo. Gute Fahrt! Von Matthias Bosenick (31.01.2006) |
|
|
|
06) |
|
|
|
Das Ruhrgebiet ist immer eine Reise wert. Wenn man dort nicht sowieso schon wohnt. Das wiederum kann man sich sehr gut vorstellen: Dort wohnen. Sobald man ins Ruhrgebiet kommt, hat man das Gefühl, dort auch willkommen zu sein. Es hat einen ganz eigenen Menschenschlag dort – und der Rest ist auch eigen. |
|
Vor ein paar Jahren wurde die „Route Industriekultur” ins Leben gerufen. Ja, das geht zusammen, Industrie und Kultur, und das wird nirgendwo deutlicher gelebt als im Pott. Sicherlich war und ist der Wandel nicht einfach, vom Arbeiter zum Dienstleister in ein paar Momenten, aber das was erreicht wurde, beeindruckt dafür umso mehr. |
|
Als viele Betriebe geschlossen wurden, hat sich nicht immer jemand gefunden, der mit den Resten etwas anzufangen wußte. So ist einiges dem Vergessen anheim gefallen oder durch Einrichtungen wie das CentrO in Oberhausen ersetzt worden. Die geretteten Komplexe und Abraumhalden hingegen wurden zu neuem Leben erweckt und strahlen zumeist in neuem Lichte: |
|
In Essen die Zeche (der Eiffelturm des Ruhrgebiets) und die Kokerei Zollverein, in Duisburg-Meiderich der Industriepark Nord, Gasometer Oberhausen, das Haldenereignis Emscherblick (der Tetraeder, genannt „Orakel von Bottrop“), die Jahrhunderthalle in Bochum, Maximilianpark Hamm (mit dem gläsernen Elefanten und dem Schmetterlingshaus), die „Bramme für das Ruhrgebiet“ in Essen, der Rheinelbepark in Gelsenkirchen, das Bergbaumuseum in Bochum, Müngstener Brücke (mit den Suizidbegehenden, die in der Pommesbude landen), … |
|
Man weiß ja schon viel, wenn man sich informiert, beziehungsweise, wenn man im Pott in Kneipen sitzt und sich von Einheimischen über dies und das aufklären läßt. Man weiß ja schon längst, daß der Pott grün ist (eine Schiffstour vom Baldeneysee über die Ruhr nach Essen-Kettwig belehrt jeden Ungläubigen), und man weiß viel über die Geschichte des Reviers. Da man aber nicht alles weiß, muß man sich bisweilen behelfen – und vorliegendes Buch ist nicht weniger als eine informative Liebeserklärung an das Ruhrgebiet. Die Autoren sind genauso begeistert wie man selbst und liefern auch noch stapelweise Informationen, die man noch nicht hatte. |
|
Und machen Neugierig auf die Ecken, die man noch gar nicht kennt. Für den Rezensenten stehen da noch aus: Zeche Nordstern, Wasserturm/Aquarius in Mülheim, Lüntec in Lünen, Halde Schwerin in Castrop-Rauxel, Halde Rungenberg in Gelsenkirchen, Schiffshebewerk Heinrichenburg, Zeche Nachtigall/Muttental in Witten, Zeche Zollern und Kokerei Hansa in Dortmund, … |
|
Mit dem Ruhrgebiet wird man nie fertig. Sobald man da ist, entdeckt man etwas Neues, will aber auch das Alte, das man bereits kennt und liebt, wiedersehen. Das kulturelle Angebot scheint größer zu sein als das Berlins – und, mit Verlaub, auch sympathischer. Das Uncoole macht den Pott so cool. Von Matthias Bosenick (24.10.2005) |
|
|
|
05) |
|
|
|
Nach diversen Kommissar-Schneider-Fällen, einer Autobiographie und einem Frauenroman wagt sich der Mann des gejazzten Wortes an die Literaturgattung seines Idols Reinhold Messner: Den Reiseroman. |
|
Dabei arbeitet er ungewohnt stringent. Als Leser seiner Werke ist man es inzwischen ja gewohnt, dass am Ende nichts mehr mit dem Anfang zu tun hat, dass von einer durchgehenden Handlung kaum die Rede sein kann und dass die Romane zumeist von den Einschüben leben, die sich ungefähr so lesen wie sich seine Bühnenauftritte anhören. |
|
Das Assoziative, das Schneider aus seiner Art zu musizieren in seinen Redefluß übernommen hat, findet aber auch in „Globus Dei“ (nebenbei, ein sehr genialer Titel für so ein Buch!) statt. Was ihm nicht alles so einfällt, während er von völlig anderen Dingen spricht. Dazu übertreibt er schamlos, prahlt, mutmaßt, interpretiert und improvisiert – und reiht eigentlich nur allgemeines Halbwissen und anerkannte Vorurteile über die Gegenden, die er beschreibt, aneinander, sodaß es am Ende für Leser mit weniger Allgemeinwissen den Anschein haben kann, er sei tatsächlich unterwegs gewesen. Bauchnabelfrei am Nordpol. |
|
Seine Reise beginnt mit einer Punktlandung mitten im ewigen Eis und endet am anderen Ende der Kugel, in Patagonien. Dazwischen reist er zunächst kontinuierlich südwärts, im Verlauf des Buches aber im Zickzack quer über die göttliche Erde. Das erweckt den Anschein, dass er schnell noch vergessene Ideen unterbringen wollte, und erinnert an den gewohnten 00-Schneider-Stil. Überraschenderweise kommt er aber immer wieder auf Elemente vom Anfang des Buches zurück, wie beispielsweise die Gegenstände, die er mit sich führt. Wer sich an seine Antarktisexpedition mit Reinhold erinnert, kann sich so einiges denken. |
|
Im Oktober soll es das Buch als Dreifach-CD geben, gelesen natürlich, wie schon „Aprikose, Banane, Erdbeer – Kommissar Schneider und die Satanskralle von Singapur“, „Mendy, das Wusical“ und auch „Eiersalat – Eine Frau geht seinen Weg“, von Helge Schneider selber. Von Matthias Bosenick (25.07.2005) |
|
|
|
04) |
|
|
|
Einen wie Thomas Pünschel kennt jeder, bestimmt. Man kennt ihn nicht richtig gut, trifft ihn aber ständig, beim Einkaufen, in der Stammkneipe oder nach Verabredung im Kino, auf Konzerten oder sonstwo. Eigentlich ist Pünschel einer von denen, die es nicht wirklich geschafft haben. Er ist Autor diverser unveröffentlichter Romane, ständig solo und doch irgendwie immer mitten dabei. |
|
Zumindest weiß er immer die besten Geschichten zu erzählen. Und die erinnern nicht selten an "Die Spinne in der Yucca-Palme". Immer, wenn man denkt, dass man weiß, wie es weitergeht, kommt irgendeine unvorhersehbare Wendung. Trotzdem mag man mit Pünschel nicht so recht selber befreundet sein; es reicht einem, dass der Ich-Erzähler Pünschels Geschichten weitererzählt. Die, nebenbei, beinahe ausnahmslos in Braunschweig spielen. |
|
Was Frank Schäfer auszeichnet, ist der ungewöhnliche Umgang mit der Sprache. Er weiß gleichermaßen mit Fremdwörterkaskaden abzuschrecken wie vulgär zu sein, am besten innerhalb eines Satzes. Noch besser sind seine Texte aber, wenn er sie selber vorliest, und deswegen ist es sehr schade, dass er an "Lemmy und die Schmöker" nicht mehr teilnehmen mag. Immerhin hat er inzwischen zwei ganze Seiten im deutschen Rolling Stone Magazine, auf die man sich monatlich freuen kann. Von Matthias Bosenick (15.02.2005) |
|
|
|
03) |
|
|
|
Wenn man weiß, dass Heinz Strunk bei Studio Braun ist (und auf VIVA "Fleischmann-TV" gemacht hat), hat man gewisse Erwartungen an "Fleisch ist mein Gemüse". Er hat bei den Telefonterroristen schon die Rolle desjenigen inne, der in Volksfloskeln spricht, ungefähr so, wie die Leute, denen man eher aus dem Weg geht, wenn sie so schon anfangen. Persifliert kann man aber darüber lachen, und in der Form war das Buch dann auch zu erwarten. |
|
Wenn man seine Stimme kennt, kann man Heinz Strunk (bzw. Jürgen Dose) durchaus reden hören, während man liest. Aber das Lachen bleibt einem schnell im Halse stecken. Unerwartet ernst und sachlich, wenn auch in der gut beobachteten Sprache seines Klientels, erzählt er von einer Jugend mit einer Mutter, die im medizinischen Sinne verrückt ist, und den daraus resultierenden Depressionen. Der Heinz des Romans ist eigentlich ein verkommenes Subjekt, depressiv, alkohol- und spielsüchtig ("Stichwort: Angstfreie Zone", um mal eine seiner Formulierungen zu benutzen), ohne Selbstwertgefühl, aber dafür im eigenen Rahmen ein selbstgerechtes Arschloch. Seine Mitmusiker stehen auf der gesellschaftlichen Leiter genauso weit unten wie er (weshalb man sich ja zusammentat), aber wie überall gibt es auch dort Hierarchierangeleien. Und wie er seine Musikschüler behandelt, ist ebenfalls Folge eines unterfüllten Machtbedürftnisses. |
|
Immerhin ist Strunk nicht der Voll-Loser. Folge seiner extrem langweiligen Jugend ist ein versiertes Blasinstrumentespiel, mit dem er seine Mitmusiker bei Tiffanys, der Tanzkapelle, die der Leser über Bucheslänge begleitet, musikalisch locker in den Schatten stellt. Und da kommt das nächste deprimierende Element: die Veranstaltungen, auf denen er zu spielen hat. Ab Harburg südwärts in der niedersächsischen Pampa, auf Schützenfesten, Lokalpromihochzeiten, Jugendtanzabenden oder Silvesterfeiern, auf Schützensälen, in heruntergekommenen Hotels oder irgendwo auf freier Pläne in gammeligen Schuppen - auf Veranstaltungen, die man, wenn man im Nordkreis Gifhorn aufwuchs, kennt und, wenn man einigermaßen Geschmack und Verstand hatte, alsbald mied. Das Publikum dort ist nicht minder mitleiderregend als die ausrangierten Exschlagerstars, die bisweilen Tiffanys als Begleitband buchen. |
|
Nicht zuletzt der erste Sex ist eines der Ziele, die Strunk in knapp 15 Jahren als Tanzmusiker verfehlt, aber mit ständigem "Abmelken" zu kompensieren versucht. Er scheitert überall auf unterem Niveau, aber dennoch deprimierend nachvollziehbar. Im Prinzip muß man "Fleisch ist mein Gemüse" und "Dorfpunks" von Strunks Studio-Braun-Kollegen Rocko Schamoni parallel lesen, denn beide erzählen von Adoleszenz auf dem Lande, aber mit gegensätzlichen Verläufen. Aus dem Punk ist immerhin "was geworden", bei Strunk fehlt am Ende jede Hoffnung auf ein besseres Leben. Das Buch ist deutlich aus heutiger Sicht geschrieben und verklärt nichts, im Gegenteil, bietet sogar noch eine selbstvernichtende, realistische Sichtweise des geschilderten Lebens. Man muß nur ausblenden, dass er später eben im "Comedy"-Geschäft recht erfolgreich wurde... von Matthias Bosenick (30.11.2004) |
|
|
|
02) |
|
|
|
Als Terry Pratchett noch unbekannter war, stand auf seinen Büchern immer "Der Douglas Adams der Fantasy", und mit vorliegendem Buch, das eigentlich bereits 1998 veröffentlicht wurde, bekräftigt er die Parallelen. Analog zu Adams "Die letzten Ihrer Art", einem Buch über Reisen zu vom Aussterben bedrohten Tierarten, das bei aller Melancholie und Wut über die scheinbare Willkür der Menschen dank Adams unnachahmlichem Stil immer wieder zum lachen anregt, erklärt Pratchett unter Zuhilfenahme zweier Wissenschaftler unser Universum anhand der Scheibenwelt, um die Ähnlichkeiten von Physik und Magie deutlich zu machen. |
|
Unnachahmlich vielleicht, aber nicht einzigartig, denn es stimmt schon, dass man die Bücher von Adams und Pratchett auch lesen und genießen kann, wenn man sich weder für Science Fiction noch Fantasy interessiert - ganz einfach, weil sie sehr gut geschrieben sind. Beide sind sprachlich und humoristisch besonders begabt und zusätzlich auch noch äußerst einfallsreich. |
|
Der Auftrag also ist hehr: die Erklärung unseres Universums anhand der Scheibenwelt. Die Zauberer bauen auf dem Squashplatz der Unsichtbaren Universität einen Atomreaktor und erschaffen eine Rundwelt, die sie beeinflussen und beobachten. In abwechselnden Kapiteln wird zwischen der UU und der Hier-Welt hin- und hergesprungen. Begonnen wird bei Atom- und Quantenphysik, über Relativitäts- und Urknalltheorie, Evolution und Darwinismus landet man bei der Zukunft der Menschheit. Mit vielen falschen Allgemeinplätzen wird aufgeräumt, man bekommt eine Menge philosophischer Denkansätze ("Die Religion der Scheibenwelt" war als Titel zunächst angedacht) und, was zu erwarten war, muß diverse Male laut lachen. |
|
Selbst, wenn man als GEO-Leser schon viel weiß, bekommt man viele Begebenheiten in ihrem Zusammenhang erklärt, beispielsweise dass Revolutionen unter anderem eine Folge des Buchdrucks waren - Herrscher konnten endlich auf die Gesetze, die sie niederschrieben, veröffentlichten, vervielfältigten und selber brachen, festgenagelt werden. |
|
Das Themenspektrum ist breit, der Unterhaltungsfaktor hoch, aber man muß schon ein gewisses Interesse für Forschung, Wissenschaft, Geschichte und Technik mitbringen, wenn man sich an dieses Buch wagt - die Passagen, die in der Unsichtbaren Universität spielen, ohne die erklärenden Kapitel zu lesen, funktioniert nämlich nicht. von Matthias Bosenick (19.11.2004) |
|
|
|
01) |
|
|
|
Man muß gar kein Punk gewesen sein, um sich in diesem Buch wiederzufinden, nicht einmal zwingend in Schleswig-Holstein aufgewachsen; als Stadtkind jedoch wird man so seine Schwierigkeiten haben. Wie war das noch, damals, in den Achtzigern, als man der dörflichen Ödnis und der elterlichen Obsorge zu entfliehen versuchte, indem man genau das tat, was verpönt war? Saufen, heimlich nachts in die nächste Dorfdisco trampen, in der Ortsmitte herumlungern und pöbeln, sich eine komische Frisur zulegen, mit den coolen Versagern abhängen, Punkrock (oder sonst was Wildes) hören - und sich doch den gesellschaftlichen Zwängen nicht entziehen können. |
|
Selbst, wenn Schamoni nicht wirklich all diese Episoden selbst erlebte, hat er sie doch sinnvoll zu einem nachvollziehbaren Stück Jugend zusammengefügt. Er verzichtet gottlob darauf, sich selbst (also die Ich-Figur) zu einem Helden zu machen, was die Identifikation vereinfacht. Da fällt es am Ende sogar leicht, mit ihm erwachsen zu werden - kein Wunder, wenn man weiß, dass er tatsächlich Musiker wurde. |
|
Der damals sogar in der Bravo erwähnte Schamoni, damals noch "King" Rocko, hat also tatsächlich Karriere gemacht, wenn auch nur im Untergrund, und ist derzeit auch noch Mitglied der anarchischen Telefonterrorgruppe "Studio Braun". Sein Gruppenkollege Jürgen Dose hat kürzlich unter dem Alias Heinz Strunk ein ähnliches Buch veröffentlicht ("Fleisch ist mein Gemüse"), über eine Jugend in Harburg, nur ohne Sex und Drogen. von Matthias Bosenick (28.10.2004) |